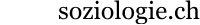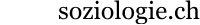|


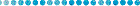



|


|
 |
 |
|
[Inhaltsverzeichnis]
[vorheriger]
[nächster]
|

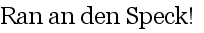
"Männer streben nach Profil, Frauen nach Linie. Männer machen Karriere,
Frauen Diäten. Wir Frauen sollen uns dünne machen. In jeder
Beziehung." (Schwarzer 1984, S. 6)
Wunderbar, nun werden endlich die Tage wieder wärmer und
frau muss sich nicht mehr in Mengen von warmen unerotischen
Winterkleidern verstecken. Die Einkaufshallen sind vollgestopft mit
dünnen Sommerkleidchen. Aber diese Zeit ist nicht nur die
Hochkonjunktur der Sommermode, sondern auch die Zeit der
Frühlingsdiäten. Oder ist es nur eine verschärfte Ganzjahrdiät, die
uns aus allen Ecken und Heftchen anlächelt? Um auf dem neusten Stand
der Dinge zu sein, muss frau nicht einmal eine Frauenzeitschrift
kaufen. Die wichtigsten Informationen schreien uns von Kiosken und
Plakaten hinterher: Frauen macht euch dünne! Unglaublich ist, dass
frau mitmacht, sich schlecht fühlt und sich in den Diätenwahn
stürzt. Der Fact, dass frau sich nach jeder Diät noch mehr Speck an
die Rippen frisst, wird kommentarlos ignoriert. Um ehrlich zu sein,
kann frau über diese Diätenvorschläge nur lachen. Winterspeck gibt
es in unserem Jahrzehnt nicht mehr, eine Frühlingsdiät ist
unangebracht, da der Kampf mit dem Gewicht viele Frauen das ganze
Jahr (oder Leben?) gefangen hält. Schlimm wird es nur, wenn die
Models dieses Frühlings schon wieder dünner geworden sind, die
Kleidchen hängen, die Knie klappern und überall um mich herum
Frauen, die diesen halbverhungerten Models ähnlich sehen. Die
Hungerkünstlerinnen haben Hochkonjunktur! Unverständlich die
Tatsache, dass trotz dem verbreiteten Wissen was Normalgewicht ist,
was Diäten nützen und wohin sie uns bringen, der schleichende
Magerkult seine Fäden weiter spinnt. Was nützen uns Prinzessin
Dianas Geständnisse und Jane Fondas Hinweise? Anorexie (Magersucht)
und Bulimie (Ess- Brechsucht) sind inzwischen zwar allgemein
bekannt, wirken jedoch nicht mehr sehr abschreckend! Hier geht es um
mehr! Es geht um den Schlankheitswahn, der sogar vor einer Sucht
nicht halt macht!Geschichte der EssstörungenSchon
vor Jahrtausenden war die Auszehrung hungernder Menschen bekannt,
Kriege, Missernte, Dürre und Regen- sowie Frostperioden waren
Ursache dieses Elends. Sehr früh richtete sich der Blick der
Menschen auf die Anwendungsmöglichkeiten der Nahrungsenthaltung.
Hungerkuren wurden eingesetzt als Behandlungsmethoden
verschiedenster Krankheiten. Aber auch die Aushungerung als Strafe
oder Druckmittel hat eine lange Tradition. Die bekanntesten
Fastenkuren wurden vor allem aus religiösen Gründen durchgeführt.
Weiter gab es auch die Verbindung von Nahrungsenthaltung und
Besessenheit, oft wurden die Fastenden mit exorzistischen Ritualen
geheilt.Den Übergang vom strengen Fasten aus religiösen Gründen
zum heutigen Krankheitsbild der Mager- und Brechsüchte bildeten die
Wundermädchen sowie die Hungerkünstler. Das Phänomen der
Wundermädchen gehörte ab dem 16. Jahrhundert zu den sensationellen
Neuheiten. Ebenso wie früher die Fastenheiligen hielten diese
Wundermädchen das Fasten angeblich monate- oder gar jahrelang durch.
Obwohl der Begriff Anorexia nervosa im 19. Jahrhundert in die
medizinische Fachliteratur eingeführt worden war, verschwand die
Sensation der Wundermädchen nicht ganz. Die hungernden Mädchen
wurden zum Teil weiter als Wunder betrachtet und nicht mit dem
Krankheitsbild der Anorexie in Verbindung gebracht. Im 19.
Jahrhundert wurde die krankhafte Abneigung gegen alle Nahrung oft
als Form der Hysterie betrachtet. Die vermehrte medizinische
Untersuchung der Fastenwunder bedeutete das Ende des
Phänomens.Einige Fastenwunder konnten sich jedoch der
Medizinalisierung entziehen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts trat
das Phänomen des Hungerstreiks in Erscheinung. Die
Selbstaushungerung wurde als eine Form des öffentlichen Protestes
eingesetzt und kann bis heute weiter beobachtet werden. Neben den
Hungerstreikenden gab es eine weitere groteske Form von Hungernden.
Diese Hungerkünstler konnten in Varietés, auf Jahrmärkten und im
Zirkus gegen Bezahlung von den BesucherInnen bestaunt werden. Im
Gegensatz zu den Wundermädchen handelte es sich bei diesen
Hungerkünstlern hauptsächlich um Männer. Dies könnte mit ein Grund
sein, warum die Hungerkünstler nicht in Verbindung mit Anorexie
gebracht wurden. Wie jedoch schon vor Jahrhunderten wurden und
werden in der Medizin mildere und selektivere Ernährungsvorschriften
bei körperlichen und psychosomatischen Leiden immer noch
eingesetzt."Obgleich die uralten Hungerkuren in
der heutigen Medizin nicht mehr üblich sind, werden sie von
zahlreichen Menschen häufiger als je zuvor angewandt. Für viele ist
die Diät nicht länger ein Heilverfahren, sondern ein wichtiger
Bestandteil eines häufig fanatischen Strebens nach Schlankheit.
Damit ist der Kreis geschlossen. Die Medizin spielte nicht nur eine
wichtige Rolle bei der Medizinalisierung der Selbstaushungerung, sie
lieferte für ein neues Leiden auch die wichtigste Methode: die Diät,
den Motor der Magersucht."(1)Die
MagersuchtAus den Wunderfrauen wurden, wie oben geschildert,
erst Kranke und im 20. Jahrhundert dann die Süchtigen. Immer höher
wurde seit der Entdeckung von Anorexia nervosa die Anzahl der
kranken oder süchtigen Frauen. Die Krankheit kann auch bei Männern
vorkommen, in 90 Prozent sind jedoch Frauen davon betroffen. Oft
beginnt es mit einer übertriebenen Diät, weil die potentiellen
Magersüchtigen sich zu dick fühlen. Die Diät wird häufig durch einen
Fressanfall unterbrochen, danach folgen noch rigorosere Massnahmen.
Immer längere Phasen der Enthaltsamkeit lassen den Körper bis auf
die Knochen abmagern. Magersüchtige haben meistens keine
Menstruation mehr, sie leiden unter Verstopfung, Überempfindlichkeit
gegen Kälte und Wärme, extremem Haarwuchs am ganzen Körper,
Verlangsamung des Pulses und anderem. Die Betroffenen haben eine
grosse Angst vor dem Dickwerden, auch bei Untergewicht, das
Verhältnis zum eigenen Körper ist gestört, das Körpergewicht
entspricht in keinem Ausmass der eigenen Gestalt.Weiter kann
auffällige körperliche und intellektuelle Hyperaktivität sowie ein
unglaubliches Leistungs- und Durchhaltevermögen trotz der enormen
Abmagerung beobachtet werden. Die Magersüchtigen zeigen einen
gestörten Umgang mit Nahrungsmitteln, ernähren sich meist von
kalorienarmen Lebensmitteln und vermeiden die normalen Mahlzeiten.
Meist leugnen Magersüchtige, dass sie krank sind und sind stolz auf
ihren Widerstand gegen die Versuchung. Die Betroffenen werden von
einem negativen Selbstbild gequält, oft führt die eigenartige
Lebensweise sogar zu sozialer Vereinsamung.Was aber führt zu
dieser Besessenheit und Selbstzerstörung? Und wieso sind es vor
allem Frauen, die sich so selber zerstören? Diese Fragen können
nicht leicht beantwortet werden. In vielen Fällen beginnt die
Magersucht in der Adoleszenz. Die Teenagerzeit ist die Zeit der
intensivierten Beschäftigung mit dem eigenen Körper. Die
Veränderungen im Körper können das Gefühl der Machtlosigkeit
erwecken, mit der Essensverweigerung kann die Situation wieder unter
Kontrolle gebracht werden, der Körper entwickelt keine weiteren
weiblichen Formen. Die Überwindung des Hungers wird als eigene
Stärke gedeutet und es entsteht ein realer oder eingebildeter
Zusammenhang zwischen dem gesellschaftlichen Status und der
Schlankheit. Der Wunsch akzeptiert und anerkannt zu werden soll
durch den schlanken Körper erfüllt werden."Die
Erscheinung, nicht Leistung ist das weibliche Mittel, um zu
demonstrieren, wie bezaubernd und begehrenswert frau ist."(2)Die Ess-Brech-SuchtNeben der
typischen Form der Selbstaushungerung, der Magersucht, erregt seit
den 80er Jahren ein neues Phänomen das Interesse der Öffentlichkeit.
Die Ess-Brech-Sucht besitzt viele Parallelen zu der Magersucht. Die
Dunkelziffer ist jedoch weit grösser. Die Bulimie oder
Ess-Brech-Sucht ist diskreter, die betroffenen Personen passen sich
problemlos in das soziale Gefüge ein, da ihre Sucht besser
verheimlicht werden kann. Eine Ess-Brech-Süchtige fällt nicht auf,
ihr Körper ist oft nicht extrem ausgehungert. Gegen aussen
funktionieren sie meist perfekt. Das Körpergewicht wird auch hier
zum Gradmesser für das Selbstwertgefühl.Merkmale der Bulimie
sind wiederholtes Auftreten von Essanfällen, die krankhafte
Beschäftigung mit dem eigenen Gewicht sowie panische Angst vor einer
Gewichtszunahme. Hinzu kommen oft auch der Gebrauch oder Missbrauch
von Abführ- und Entwässerungsmitteln. Aus Schuldgefühlen bei jeder
Mahlzeit treiben Ess-Brech-Süchtige oft übermässigen Sport. Aus der
panischen Angst dick zu werden entwickelt sich oft zusätzlich eine
Art Sportsucht.Ein Mangel an Selbstvertrauen zeigt sich bei
bulimischen Frauen in der Einstellung zum eigenen Aussehen. Diese
ist eher Negativ und gezeichnet durch die Angst einer
Gewichtszunahme. Der Eindruck, nicht attraktiv zu sein, löst
Verunsicherung und einen Verlust des Selbstwertgefühls aus. Aus
diesem Grund wird viel Wert auf die Verschönerung des äusseren
Erscheinungsbildes gelegt, die Motivation das Schönheitsideal zu
erreichen ist sehr gross. Hier stellt sich natürlich die Frage nach
den Ursachen dieser Erkrankung. Erklärungsansätze bieten sich auf
drei Ebenen an: Gesellschaft, Familie und Persönlichkeit. In unserer
Gesellschaft scheint es einen fruchtbaren Boden für diese fast
epidemieartige Ausbreitung der Ess-Brech-Sucht zu geben. Als eine
Ursache kann der Schlankheitskult der letzten Jahrzehnte betrachtet
werden. Im Rahmen des feministischen Ansatzes - Kritik der
Ungleichbehandlung von Frau und Mann in unserer Gesellschaft - wird
davon ausgegangen, dass bulimische Frauen ganz mit der
traditionellen weiblichen Geschlechtsrolle verschmolzen sind. Diese
Aussage kann jedoch in Untersuchungen nicht bestätigt werden.
"Gerade bulimische Frauen haben grosse
Schwierigkeiten, sich unangenehme Gefühle wie Wut, Ärger,
Traurigkeit, Langeweile einzugestehen und sie zu zeigen. Dahinter
stehen meist - neben dem Bedürfnis, es jedem recht machen zu wollen
- erlernte Lebensregeln, die das Äussern bestimmter Gefühle
verbieten." (3)Ein weiterer
Erklärungsansatz zur Ursache von Bulimie ist die Familie. Bulimie
wird als Resultat einer gestörten Familienatmosphäre betrachtet
sowie als Ausdruck einer schwierigen Mutter-Kind-Beziehung. Der
dritte Erklärungsansatz setzt bei der psychischen Struktur einer
Bulimikerin an. Forschungsergebnisse können jedoch keinen sicheren
Aufschluss darüber geben, ob es die bulimische Persönlichkeit
überhaupt gibt. Relativ häufig beobachtet wurden: Probleme, Stress
zu bewältigen; Depressionen; mangelnde Selbstkontrolle und
Suchtverhalten; Perfektionismus und Zwanghaftigkeit, geringes
Selbstwertgefühl und Kontaktprobleme sowie ein negatives Körperbild.
Diese Merkmale unterstützen die Annahme, dass Bulimikerinnen sich
auch in anderen Bereichen als dem Essverhalten von anderen Menschen
unterscheiden.Die Häufigkeit der Ess-Brech-Sucht hat in letzter
Zeit auch bei den Männern stark zugenommen. Nach neueren
Forschungsresultaten sind es sogar bis zu 4 Prozent der Männer, die
ihr Gewicht gelegentlich bis häufig durch selbstinduziertes
Erbrechen kontrollieren. Der das Schönheitsideal diktierende
schlanke Supermensch macht immer weniger auch vor den Männern halt.
Der Körperkult hat auch das männliche Geschlecht
eingeholt!Wie wir nun gesehen haben gibt und
gab es unterschiedlichste Formen von Essstörungen. Als Kriterien für
ein gestörtes Essverhalten gelten: Das Essverhalten ist
angstbesetzt, überwiegend aussenorientiert, rigide, chaotisch,
abwechselnd rigide und chaotisch, Mittel zur Stressbewältigung,
extrem gewichtsabhängig und es kontrolliert die Gedanken.(4)Die erwähnten Essstörungen können oft nicht
einzeln betrachtet werden. Aus einer rigorosen Diät kann Magersucht
entstehen, die Magersucht wird durch Fressanfälle unterbrochen und
diese sollen durch Erbrechen, Abführmittel oder übermässigen Sport
wieder rückgängig gemacht werden usw. Oft löst eine Sucht die andere
ab; eine Heilung ist ein langer aber möglicher Prozess."Fressen bis zum Erbrechen, weil das Leben zum Kotzen
ist. Hungern bis zum Tode, aus Hunger nach dem Leben. Es gibt viele
Motive für die Flucht in die Welt der Diäten, die nicht selten im
Käfig einer Sucht endet. Eines steht immer dahinter: die
Unerreichbarkeit der geforderten Traumfigur. Und die zunehmende
Unfähigkeit, anders zu sprechen als durch den Körper. Gleichzeitig
aber sind Frauen in diesem Körper Fremde geworden. Nicht sie selbst
bestimmen über ihn, andere diktieren, wie er zu sein hat. So ist die
letzte Macht von Frauen oft die Ohnmacht der Selbstzerstörung." (5)Hilfe für Mager- und
Ess-Brech-Süchtige
Zürich:
Universitätsspital, Abteilung für psychosoziale Medizin , Tel. 01/255'’5'2’
Team Selbsthilfe, Tel. 01/ 252'30'36.
Beratungsstelle für Essstörungen Tel. 01/ 463'55'66
Basel:
Psychiatrische Universitätspolyklinik, Tel. 061/ 692'80'70
Bern:
Psychiatrische Universitätspolyklinik, Tel. 031/ 632'88'11
St.Gallen:
Selbsthilfegruppe, Tel. 071/ 22'97'16
Literatur
Kämmerer, Annette/ Klingenspor, Barbara (Hrsg.): Bulimie. Zum Verständnis
einer geschlechtsspezifischen Esstörung. Stuttgart 1989.
Kloth, Brigitte: Zum Kotzen. Tübingen 1992.
Langsdorff, Maja: Die heimliche Sucht, unheimlich zu essen. Frankfurt/Main 1992.
Orbach, Susie: Anti-Diät-Buch 1+2. München 1989 + 1991.
Vandereyken, Walter/ van Deth, Ron/ Meermann, Rolf:
Hungerkünstler, Fastenwunder, Magersucht. Eine Kulturgeschichte
der Esstörungen. München 1992.(zurück zum Text)
Wolf, Naomi: Der Mythos Schönheit. Hamburg 1991.
Stahr, Ingeborg/ Barb-Priebe, Ingrid/ Schulz, Elke: Esstörungen
und die Suche nach der Identität. Ursachen, Entwicklungen und Behandlungsmöglichkeiten.
München 1995.
Schwarzer, Alice (Hrsg.): Durch dick und dünn. Reinbek
bei Hamburg 1984.(zurück zum Text 1)(zurück
zum Text 2)(zurück zum Text 3)
Becker, Kuni: Die perfekte Frau und ihr Geheimnis.
Ess- und Brechsucht: Hilfen für Betroffene und Angehörige. Reinbek
bei Hamburg 1994. (zurück zum Text 1)(zurück zum Text 2)
Albonico, Catrin: Wer verwandelt das erbrochene Brot. Ein Krankheits-
und Heilungsbericht zur Bulimarexie (Ess- Brech- Sucht). Schaffhausen
1994.
Linder, Michaela: Sucht und Sehnsüchte. Ein Erfahrungsbericht zur
Bulimie. Freiburg im Breisgau 1993.
1 Vandereycken 1992, S. 147
2 Schwarzer (Hg), S. 73
3 Becker 1994, S. 174
4 Becker 1994, S. 20ff
5 Schwarzer 1984, S. 8
|

|
[Inhaltsverzeichnis]
[vorheriger]
[nächster]
|
|
 |


|
 
|
   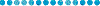 

|