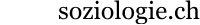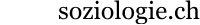|


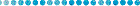



|


|
 |
 |
|
[Inhaltsverzeichnis]
[vorheriger]
[nächster]
|

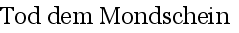

Einige Notizen zur Ästhetisierung von Technologien im Futurismus und der neueren
Science Fiction

|
Inwiefern unterscheiden sich "Technik" und "Kultur"? Wo beginnt der Bereich der
Technologie, wo derjenige der Kunst? Ist dies, ob der gewichtigen Probleme, die sich
über die tiefgehenden technologischen Umbrüche und "Folgewirkungen" stellen, nicht eine
müssige Frage?
|
Dass Technologien gesellschaftliche Strukturen und Lebenswelten weitreichend verändern,
ja gar substantiell bedrohen, darüber scheint auch bei sonst gegensätzlichen
Standpunkten weitgehend Einigkeit zu bestehen. Ebenso wird das Verabschieden einer
maschinenorientierten Industriegesellschaft gemeinhin als eines der weitreichendsten
Elementen des sozialen Wandels aufgefasst. Meint in Anbetracht dieser Bedeutungsschwere
die Frage nach der Ästhetisierung der Technologien nicht bloss eine Frage nach der
beschönigenden Oberfläche? Eine möglicherweise falsche Frage nach dem Ornamentalen, das
den Blick vom Wesentlichen auf das bloss Gefällige lenken will?
Indes: Kunst und Technik waren lange Zeit nicht zu trennen. Die griechische techne
bezeichnete sowohl Kunst wie auch spezifische Fertigkeiten, also "Techniken". Dass ein
Mensch sich als "Künstler" bezeichnete, war lange Zeit schlicht nicht vorstellbar.(0)
Herstellung von etwas war immer schon Kunst, wie sich am Beispiel der Architektur, die
weder "reine" Technik noch "blosse" Kunst ist, unschwer erkennen lässt. Dass der Aspekt
der techne ob dem oft beschworenen Gegensatz von Technik und Kultur keineswegs
verschwunden ist, hat zu Beginn dieses Jahrunderts der Futurismus als eine der ersten
Avantgarde der Moderne nachhaltig gezeigt.
|
Inwiefern das Technologieverständnis und die Ästhetik des Futurismus in aktuellen
kulturellen Bewegungen wieder auftauchen, die mit einem Kult um "Cyberspace" und
"Cyborg" inzwischen wesentliche Deutungen der Gegenwart liefern (mit "Cyberspace",
"Matrix", "virtuelle Realität" seien nur einige der Begriffe genannt, die im
wesentlichen von der Science Fiction geprägt sind) ist keineswegs einfach zu
beantworten. Indessen stellen gerade diese beiden "Ästhetisierungswellen" von
Technologien die Frage nach dem Gehalt einer immer wieder hochgehaltenenen Bedrohung
der kulturellen bestimmten Lebenswelten durch eine Unterwerfung unter technologische
Rationalität.
|
Welt ohne Mondschein: der Futurismus
|
Bevor sich eine eigentliche futuristische Kunst oder Literatur abzuzeichnen begann,
hatte sich die futuristische Bewegung bereits als ein karnevaleskes Spektakel in den
grösseren Städten inszeniert, was dem Futurismus durchaus den Charakter einer "sozialen
Bewegung" verlieh. Die Anfänge der futuristischen Avantgarde sind denn nicht unbedingt
in einem gewissermassen "paradigmatischen Kunstwerk" zu suchen, das ein neues
kulturelles Verständnis einleitete, sondern in einem 1909 von F. T. Marinetti
verfassten Manifest. In dieser Schrift beabsichtigte der Literat "eine systematische
Denunziation des Antiken, des Alten, des Langsamen, des Gelehrten".(1) Auf kultureller
Ebene war es vornehmlich die etablierte Kunst der Akademien und Museen, gegen die sich
die futuristische Bewegung wandte. Nach Ansicht der Futuristen hatte sich diese von der
Lebenswirklichkeit längst entfernt. Gegen die "romantische Doktrin des
‘Organischen’",) der verklärten Natur, artikulierte Marinetti "... eine
enthusiastische Glorifizierung der wissenschaftlichen Entdeckungen und des modernen
Mechanismus".
|
Die moderne Technologie faszinierte insbesondere in ihren neuen Möglichkeiten, Zeit und
Raum über maschinengetriebene Fortbewegungsmittel zu überwinden. "Zeit und Raum sind
gestern gestorben", schrieb Marinetti mit unverhohlenem Pathos, "wir leben bereits im
Absoluten, denn wir haben schon die ewige gegenwärtige Geschwindigkeit geschaffen". Die
Naturverherrlichung der Romantik, des Symbolismus und Ästhetizismus wurde lediglich
noch mit Verachtung begegnet. Dem "Mondschein" war "der Tod" angesagt. Diese radikal
umgestalteten Lebensverhältnisse, welche die Futuristen zu begreifen und zu
ästhetisieren versuchten, erforderten indes auch eine neue Auffassung des menschlichen
Wesens. Der Mensch bildete nun keineswegs mehr ein Gegensatz zur Maschine, sondern eine
enge Verwandtschaft wurde offenbar. Die "Verschmelzung von Kunst + Wissenschaft,
Chemie, Physik, beständiges Feuerwerk, bringen unerwartet das neue automatisch
sprechende Wesen hervor, das schreit und tanzt", wird in einem weiteren Manifest dieses
neue Maschinenwesen umrissen - ein Wesen, das sich mimetisch der Kraft und Energie der
Lokomitiven, Dampfmaschinen und Fabriken der Industriegesellschaft annähert. Damit sah
der Futurismus "die Ära der grossen mechanischen Individualität angebrochen", die ein
anderes Menschenbild in Anlehung an die Ästhetik, Logik und Energie der Maschinen des
Industriezeitalters umfassen sollte: "Der für eine allgegenwärtige Geschwindigkeit
geschaffene ahumane und mechanische Typus", so erwartete ein weiteres Manifest, "wird
natürlich grausam, allgegenwärtig und kampfbereit sein". Hierin kommt in der Bewegung
auch ein bis zum Exzess gesteigerter Vitalismus zum Ausdruck, der unter mechanischer
Panzerung nichts anderes als die Sehnsucht nach der Negation von allem, seiner
Zerstörung verbirgt. Der Krieg erscheint letztlich als die "einzige Hygiene" der Welt.
|
Eine Ästhetik des technologischen "Schocks"
|
In dem Versuch, "auf brutale Weise das Leben in die Kunst einzuführen", in der damit
einhergehenden Negation der etablierten kulturellen Ordnung, darf der Futurismus
geradezu als Idealbild einer avantgardistischen Bewegung betrachtet werden, die mit
ästhetischer und politischer Programmatik eine sich verselbständigende kulturelle
Sphäre wieder mit der Realität veränderter Lebensverhältnisse konfrontieren wollte. Die
futuristische Avantgarde bediente sich dabei der rhetorischen Mittel des
Schockierenden, des Karnevalesken, der "ästhetischen Usurpation", die die harmonischen
Verklärungen der romantischen Kultur ironisch mit einer dagegen gewendeten Verklärung
des Maschinellen, der Technologien zerstört. Der veränderten Lebenswirklichkeit näherte
sich der Futurismus indes nicht über realistische Darstellungen, sondern über den
Versuch einer mimetischen Annäherung an die Logik des Maschinellen. Die Ästhetisierung
konnte nicht als eine realistische Repräsentation erfolgen, die einer überkommenen
Kunstauffassung entlehnt wäre, sondern mussten sich auch in der Form der
Geschwindigkeit, der Fragmentierung an das industrielle Zeitalter angleichen.
|
Für den Literaturwissenschafter Peter Bürger ist es gerade das Ziel avantgardistischer
Projekte, Kunst von einer verselbständigten, folgenlosen Ästhetik in die "Lebenspraxis"
zurückzuführen.(3) Diese Rückführung gestaltet sich jedoch keineswegs in Form einer
pädagogischen, aufklärerischen Offensive, eher könnte sie entlang der Arbeiten Walter
Benjamins als eine Form eines "ästhetischen Schocks" begriffen werden, der eben die
verhüllende und verklärende "Aura", die die Gesellschaft mit dem Natürlichen und der
hohen Kultur versöhnen wollte, zertrümmert.(4) Benjamin diskutiert eine "Ästhetik des
Schocks", wie sie etwa der Surrealismus zelebriert, als eine Kritik an der Auffassung
der Kunst als etwas homogenes, monolythisches, das gleichsam losgelöst über der
Gesellschaft schwebt. Über einen karnevalesk inszenierten ästhetischen Schock wird
dieser Schein ebenso zerstört wie die harmonische Vorstellung einer mit sich selbst in
Einklang stehenden Gesellschaft.(5) Von ihren anarchistischen, dekonstruktivistischen
Anfängen wandte sich die futuristische Bewegung indes zusehends ab und hob das Begehren
nach Zerstörung immer stärker hervor, eines Begehrens, das letztlich seine Aufhebung in
jener politischen Bewegung fand, welche die maschinell-industrielle Vernichtung auf
alle Bereiche des Lebens am nachhaltigsten durchsetzte.
|
Das Ende der Humanoiden - die Ästhethisierung von Technologien in der neueren
Science Fiction
|
In mancher Hinsicht gleichen aktuelle kulturelle Bewegungen, die um einen eigentlichen
"Cyber" - Kult die neuen Technologien als Bestandteil alltäglicher Lebenspraxis
ästhetisiert, in ihrem Impetus durchaus der futuristischen Avantgarde. Diese neue
Bewegung ist in ihrer formalen und inhaltlichen Ausgestaltung am ehesten in der Science
Fiction - Literatur zu erkennen, die selbst Funktion der Extrapolation technologischer
Entwicklungen, von marginalen kulturellen Milieus gepflegt, aufgegeben hat und sich zum
Ort der literarischen Auseinandersetzung mit dem Gegenwärtigen gewandelt hat.
Entstanden ist diese Bewegung wahrscheinlich aber in der Pop Musik.(6) In Abgrenzung
des Idealismus und Romantizismus der Protestkultur der 68er Bewegung und des
Hippiekults artikulierte sich eine Kultur des technoiden, nihilistischen New Wave und
Punk, des "No Future". Während sich die Protestsongs der 60er und 70er Jahre noch mit
akkustischer Gitarre und nach Liederbuch gemeinsam in freier Natur singen liessen, war
New Wave und Punk ohne Elektronik, ohne geballte Kilowatts elektronischer Verstärkung
nicht denkbar. Elektronik, jenes neue Element des technologischen "Wandels", war flugs
keineswegs ein äusserliches, bedrohendes Element der Protestkultur mehr, sondern
Bestandteil der ästhetisierten Lebenswelt selbst. Literarisch fand diese Bewegung ihren
Ausdruck in einer neueren Welle von Science Fiction Stories und Romanen, die bald ein
breiteres "Lebensgefühl" ausdrückten. Cyberpunk, ein Kunstwort aus der Verbindung von
cybernetic und punk, Cyborgs, wiederum gebildet aus cybernetic und organism sowie
Cyberspace, ein Begriff, der Computertechnologie mit sinnlich wahrnehmbaren Raum
verbinden will, werden zu Leitmetaphern einer neuen kulturellen Bewegung, die sich
gegen die "anti-artifizielle, antitechnische Ästhetik der Gegenkultur" der siebziger
Jahre wandte und das Element des Sprachlichen, des Codes, der kybernetischen
Informationsverarbeitungen über dasjenige des a priori existierenden Natürlichen
stellt.(7) Wie der Futurismus wollen die Manifestationen des Cyberpunk und der Science
Fiction Kultur die etablierte kulturelle Ordnung, die sich von der Realitätswahrnehmung
entfernt hat, unterwandern und Technologien als Bestandteil und nicht als ein Aussen
der Lebenswelt verstehen. In einem der Manifeste, welche diese Science
Fiction-Bewegungen begleitete, schreibt Bruce Sterling, einer der Apologeten der
Bewegung:
|
"The cyberpunks are perhaps the first Science Fiction generation to grow up not only
within the literary tradition of Science Fiction but in a trurely
science-fictional-world." (8)
|
Die literarische Funktion des Science Fiction wandelt sich unversehens von blosser
wissenschaftlich begründeter Fiktion zur Benennung des alltäglichen Lebens. William
Gibson, dem die Rolle eines Gründers des Cyberpunk-movements zugesprochen wird,
formuliert dies ähnlich wie Sterling: "Readers who think that Science Fiction is
‘about’ future are naive - people have to live with things far grimmer and stranger
than what’s found in the most Science Fiction. This is the future."(9)
|
Gemeinsamkeiten und Differenzen in der Ästhetisierung des technologischen Schocks
|
Sowohl der Futurismus wie der Cyberpunk fassten sich gegen eine Verklärung des
"Natürlichen", gegen eine von Romantik verbrämten Harmonie der Natur und menschlichen
Gesellschaft. Beide Bewegungen nahmen die Technologie in ihren Darstellungen auf, um zu
verwirren, um in einem semiotischen Karneval Eingefahrenes zu überwinden und eine als
lebensfern empfundene "Kultur" umzugestalten. Auch die rhetorischen Mittel des
Futurismus und des Cyberpunk gleichen sich in gewisser Hinsicht: über eine
Ästhetisierung des technologischen Schocks, den das Industriezeitalter und die
anbrechende "Informationsgesellschaft" gleichermassen bereiteten, soll versucht werden,
die Lebenswelten neu zu begreifen. Dies bedarf aber beide Male einer Verabschiedung der
etablierten kulturellen Ordnung, in der sich die Bewegungen nicht mehr repräsentiert
sehen, die als "lebensfremd" empfunden werden. In karnevalesken Veranstaltungen, die
den Futuristen wie die (Cyber)punks gleichermassen inszenierten, wird ihre
"Weltfremdheit" ironisierend verabschiedet.
|
Die Gemeinsamkeiten zwischen Futurismus und Cyberpunk erschöpfen sich indessen bald.
Einerseits traten die Futuristen als Avantgarde auf, die beinahe manichäisch Neues
zelebrieren und Altes zerstören wollte. Die neuere Science Fiction - Bewegung darf
indessen unbestritten als Bestandteil einer kulturellen Postmoderne verstanden werden,
die sowohl Konstruktionen wie "Neu" und "Alt" ebenso wie diejenige der Avantgarde
verwirft (wobei offengestellt ist, wie Terry Eagleton dies vermutetet, ob die
Postmoderne nicht selbst eine Form der Avantgarde darstellt).(10) Ein Kunstwerk oder
eine literarische Arbeit hat nicht mehr den Anspruch auf Originalität, auf Wahrheit
oder Echtheit, sondern baut als eine Art grosse Pastiche verschiedenste
Äusserungsformen ein, nimmt Fragmente vergangener Diskurse und Ästhetiken spielerisch
auf und verfremdet damit jeden Anspruch, etwas Kohärentes, Einheitliches zu
repräsentieren. Ein weniger autoritärer Duktus im Umgang mit dem Anderen ist die Folge,
der die "Führungsfunktion" einer kultureller Elite, wie sie im Avantgarde-Gedanken noch
vorhanden ist, als obsolet erscheinen lässt. Die von Kitsch überfrachtete ausgiebige
Darstellung eines Sonnenuntergangs am Meeresstrand in einem Schlüsselroman des
Cyberpunk mag für einen solchen Umgang mit dem vergangenen Anderen stehen, welche die
Science Fiction-Bewegung hinter sich gelassen hat. Die Szenerie frönt unverhohlen der
Naturromantik - aber sie ist, wie kann es auch anders sein, bloss computertechnisch
generiert. Das "Naturschöne" ist damit keineswegs verbannt, vernichtet, sondern in
einem Tableau anderer Ästhetiken als ironisches Zitat nach wie vor möglich.(11)
|
Vielleicht steht dieser respektlose Charakter der neueren Ästhetisierungen, der
Organisches, Romantisches, zuweilen Mystisches unverfroren mit "rein" Technischem
vermengt und vielleicht gerade deswegen mit autoritären politischen Programmen wenig
anzufangen weiss, auch mit der Art der Technik zusammen, welche die Lebensverhältnisse
bestimmt. Die Maschinen des Industriezeitalters forderten eine bestimmte
hierarchisch-autoritäre Struktur der Produktion und Reproduktion, sie sind stets ein
Aussen des menschlichen Körpers, können ihn mit roher Gewalt zerstören, vernichten. Die
neuen kybernetischen Technologien arbeiten indes mit Sprache, dem ureigensten Mittel
der menschlichen Lebenswelten, produzieren Information, verändern Wahrnehmung,
Gedächtnis und drohen ob der Menge der Datenströme, Versuche der autoritären
Festschreibung von "Sinn" und "Bedeutung" immer wieder zu unterwandern. Eine
futuristische Utopie lässt sich vor dem Hintergrund dieser potentiell semiotisch
subversiven Technologien kaum mehr artikulieren, nur ein verschmitztes Registrieren
unzähliger Heterotopien. Ob damit lediglich die Anfänge der Ästhetisierung neuer
Technologien dargestellt ist, sei dahingestellt, vielleicht taucht auch in dem
Zeichengewirr der neuen Science Fiction Welt unversehens die Grimasse einer neuartigen
autoritären Ordnung auf; zumal sich auch der Futurismus zu Beginn chaotisch, ironisch
und dekonstruktiv gezeigt hatte. Diejenige technologische Ästhetik und
gesellschaftliche Ordnung jedoch, die der Futurismus letztlich artikulierte, erscheinen
einem "Helden" in einer Erzählung von William Gibson lediglich noch als "semitioscher
Spuk", als Tag-Albtraum einer "perfekten", aber merkwürdig leeren, maschinellen
Welt.(12)
|
Was die eingangs gestellte Frage betrifft, nämlich nach dem Gegensatz von Kunst und
Technologie: so scheint sie in der Tat falsch gesellt. In kulturtheoretischer und
soziologischer Hinsicht erscheint die Kultur gemeinhin als bedrohte Exklave des noch
Menschlichen gegenüber den unterwerfenden Mechanismen technischer Rationalität. Der,
beinahe "hausmütterlich" aufzufassenden Aufgaben der Kultur, nämlich konsensfähige
Deutungsmuster zu liefern und einer Sinnentleerung in der modernen Welt
entgegenzuwirken, stehen in etablierter Theorie die kalten Mechanismen ökonomischer und
technischer Rationalität gegenüber, welche die von kulturellen Verständigungsmustern
notbehelfs zusammengehaltenen Lebenswelten zu unterwerfen drohen.(13) Technik oder
Technologie werden stets als ein "Aussen" der Kultur betrachtet, eines Aussen, das
wiederum die "Funktionen" der Kultur nachhaltig verändert, stört, oder gar
unterwirft.(14)
|
Bezeichnenderweise sind es gerade zwei kulturelle Bewegungen, welche die "Aporien"
dieser "falschen" Gegensätze aufnehmen und über eine Ästhetisierung der Technik die
problematischen Oppositionen hinterfragen, ja destruieren. Allenfalls müsste in der
Sichtweise sowohl des Futurismus wie der neueren Science Fiction nicht von einer
kulturellen Entfremdung durch die Technologie sondern gerade über die Kultur selbst
gesprochen werden, die sich in einem zunehmenden Autonomisierungsprozess von den
"konkreten" Lebensverhältnissen abgelöst hat. Die kulturellen Bewegungen, die eine
Ästhetisierung der Technologie vornehmen, verwerfen, unterwandern und verunsichern
damit etabliertes soziologisches Ordnungsdenken. Ihnen zu lauschen wäre auch eine
Möglichkeit für das Verständnis des Gegenwärtigen. Schlussendlich ist noch niemand von
einem Computer erschlagen worden.
|
0 Vgl. hierzu die "klassischen" Ausführungen von Ernst Gombrich (Die Geschichte der
Kunst, Belser, Stuttgart und Zürich, 1986, S. 29) über die "seltsamen Anfänge" der
Kunst.
|
1 Vgl. zur Darstellung des Futurismus: Schmidth-Bergmann, Hansgeorg (1993): Futurismus.
Geschichte, Ästhetik, Dokumente. Reinbek bei Hamburg: Rohwolt. Sowie: Appollonio, Umbro
(1966): Der Futurismus. Manifeste und Dokumente einer künstlerischen Revolution
1909-1918. Schauberg: DuMont. Diesen Werken sind auch die Zitate der einzelnen
Manifeste entnommen.
|
2 Vgl. zur kultursoziologischen Deutung des Futurismus: Hauser, Arnold (1988):
Soziologie der Kunst. München: Beck, S. 724 ff.
|
3 Bürger, Peter (1974): Theorie der Avantgarde. Frankfurt a. Main. Suhrkamp, S. 29.
|
4 Vgl hierzu Benjamin, Walter (1997): "Die Zertrümmerung der Aura", in: Gesammelte
Schriften I.2, S. 439 ff. Die Zetrümmerung der Aura wird hierin im Kontext einer
technischen Reproduzierbarkeit des Kunstwerk betrachtet.
|
5 Vgl. Zima, Peter V. (1995): Literarische Ästhetik. Tübingen und Basel: Francke, S.
143 f.
|
6 Vgl. zur Darstellung der Geschichte des Cyberpunk: Spinrad, Norman (1995): "Die
Neuromantiker". Nachwort zu William Gibson: Neuromancer. Heyne: München. S. 349-366.
Sowie: Sterling, Bruce, 1986, "Preface" in (derselbe)(Hrsg.): Mirrorshades. The
Cyberpunk Anthology, New York, Arbor House, vii-xiv.
|
7 Spinrad, a.a.O., S. 357. Zum Primat des Codes über die Natur vlg. Haraway, Donna
(1995): Ein Manifest für Cyborgs." In: Die Neuerfindung der Natur. Primaten, Cyborgs
und Frauen. Frankfurt a. Main, New York: Campus.
|
8 Sterling, a.a.O, S. IX.
|
9 Interview mit Willaim Gibson, zitiert nach Olsen, Lance (1992): William Gibson. San
Berardino, California., S. 10f.
|
10 Vgl.l zur Darstellung der Postmoderne in der ästhetischen Diskussion: Eagleton,
Terry (1994): Ästhetik. Die Geschichte ihrer Ideologie. Stuttgart, Weimar: Metzler.
|
11 Gibson, Neoromancer, a.a.O.
|
12 Gibson, William (1994): "Das Gernsback Kontinuum", in (derselbe): Vernetzt. Johnny
Mnenomic und andere Geschichten. Franfurt a. Main. Rogner & Bernhard.
|
13 Vgl. Jürgen Habermas (1988): Theorie des kommunikativen Handelns. Zweiter Band.
Frankfurt a. Main: Suhrkamp, S. 212 ff. und Jürgen Habermas (1969): "Technischer
Fortschritt und soziale Lebenswelt", in (derselbe): Technik und Wissenschaft als
‘Ideologie’, Frankfurt a. Main: Suhrkamp, S. 104 - 119.
|
14 Die Tatsache, dass die moderne Technik in die ursprünglichen Lebenswelten
eingebrochen ist, stellt für Berger, Berger und Kellner gerade ein Bestandteil des
"Unbehagens in der Modernität" dar.
|
15 Gleiches, wenngleich mit weniger apokalyptischem Duktus, lässt sich in Becks
Beschreibung der "Risikogesellschaft" (Frankfurt a. Main: Suhrkamp, 1986, S. 324 ff.)
nachlesen.
|
|

|
[Inhaltsverzeichnis]
[vorheriger]
[nächster]
|
|
 |


|
 
|
   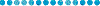 

|