 |


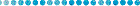



|


|
 |
 |
|
[Inhaltsverzeichnis]
[vorheriger]
[nächster]
|

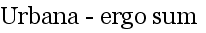

Ein kleines Plädoyer für eine städtische Lebensweise

|
Wie bitte, habe ich richtig gehört? Erworbene Eigenschaften sollen sich nicht
vererben? Dabei bin ich selbst das beste Beispiel für das Gegenteil.
Bekanntlich, so will es der träfe Volksmund, fällt der Apfel nicht weit vom
Stamm. Und der Volksmund, wir wissen es allzu gut, hat immer recht.
|
Worum geht es eigentlich?
|
Ganz einfach. Um die Frage, ob eine/r mit Vorliebe in der Stadt lebt oder am
Abend heilfroh ist, wenn er/sie ins Grüne zurückfahren kann.
|
Und ich, die ich mit Vorliebe in der Stadt lebe, versuche gerade herzuleiten,
warum das so ist. Und wenn man etwas herleitet, beginnt man meist mit den
Eltern. Also, wie war das schon wieder mit meinen Eltern und ihrer Urbanität?
|
Beide sind auf dem Land aufgewachsen. Meine Mutter in einem stattlichen Dorf
des Zürcher Weinlandes, das für seinen guten Tropfen ebenso berühmt ist wie
für die saftigen Spargeln. Als sie sechzehn war, zog ihre Familie wegen der
Ausbildung der Kinder nach Zürich. Meine Mutter war überglücklich, dass sie
jetzt zu der grossen Masse der Werktätigen gehörte, die allmorgendlich hinter
Verkaufstresen, Werkbänken und Schreibmaschinen und allabendlich in Kinos und
Bars flutete.
|
Stadt macht mobil - Jugend macht Mode
|
Im gleichen Alter wurde mein Vater zum Städter. Allerdings ohne dass die
Familie umgezogen wäre. Vielmehr war es hier genau umgekehrt. Nicht die
Menschen machten mobil, sondern die Stadt. Sie kam plötzlich von Hirslanden
her den Berg heraufgekrochen und streckte die Hand nach Vaters Dorf aus.
Zweite Eingemeindung hiess das offiziell. Sie versetzte die Witikoner
Dorfjugend in einen Modernisierungstaumel. Wer jetzt noch wie die Eltern
Bauern werden wollte, hatte die Zeichen der Zeit nicht erkannt, galt als
hoffnungslos veraltet. An den Kleidern sah man es zuerst, später an den
Wagen, die sich einige Dorfjünglinge zulegten. Mein Vater war bestimmt der
eleganteste Dandy des ganzen Dorfes. Er trug weiss-braune italienische
Schuhe, zum Autofahren Garnhandschuhe mit Lederverstärkung und immer einen
perfekten Anzug mit Seidenkrawatte. In den 50-ern legte er sich noch eine
Haartolle à la Elvis zu, so dass ihn niemand mehr von einem
Hollywoodschauspieler unterscheiden konnte, der an der sommerlichen Riviera
sein Glück macht.
|
Allerdings machte er sein Glück im Winter beim Skifahren, wo er mehr an der
Après-Ski-Bar als auf der Piste in Erscheinung trat. Dort traf er dann auf
meine Mutter, die als filmbegeisterte junge Dame für weltmännisches Auftreten
just eine Schwäche hatte.
|
Klar, dass es auf der Stelle funkte und die beiden sich in der Zürcher
Innenstadt, in der Pfauengegend, eine gemeinsame Bleibe einrichteten. Meine
Mutter genoss dort die Nähe zu Kunst, Theater und See. Mein Vater die
Platzkonzerte auf dem Bürkliplatz, die riesige Auswahl von Restaurants und
die Sonntagsausflüge hinaus aufs Land, wo man der zurückgebliebenen
Verwandtschaft von beiden Seiten allsonntäglich ein wenig Stadtluft
mitbrachte. Wegen der langen Fahrten fanden wir Kinder diese Ausflüge einfach
scheusslich. Überhaupt bekamen wir das Autofahren so satt, dass wir bis heute
eine unüberwindliche Abneigung dagegen haben und das Zu-Fuss-Gehen und
Tramfahren aus Überzeugung zelebrieren. Nur schon deswegen sind wir in der
Stadt gut bedient.
|
Überzeugte Städter sind wir aber nicht bloss wegen der Stadt-Begeisterung
unserer Eltern, die uns in tausend Facetten vorgelebt wurde, sondern wegen
der in unseren Kindertagen erlebten Mischung aus Abwechslung und Anregung,
die der innenstädtische Lebensraum und anbot.
|
Als Kleinkinder bewegten wir uns auf einer fast quadratischen grünen Insel,
die von vier Strassen gesäumt wurde. Diese standen im rechten Winkel
zueinander und schlossen ungefähr zehn Wohnhäuser plus Gärten, eine Bäckerei,
eine Gemüsehandlung und eine Skifabrik ein. Da war auf kleinstem Raum alles
vorhanden, was wir zum Spielen brauchten: Rasen für alle möglichen Ballspiele
und Zirkusaufführungen, ein Hof für Seifenkistenrennen, ein alter
verwunschener Villengarten mit Springbrunnen und Putten, wo wir Dornröschen
und Froschkönig aufführten und die hohe Fabrikmauer aus Backsteinen und
Stacheldraht, die in fortgeschrittenem alter zum Politspiel reizte: Wer es
schaffte, von Ost- nach Westberlin über die Mauer zu klettern und am
Sicherheitsoffizier, sprich Hauswart, der dort lauerte, vorbeizukommen, war
Held des Tages. Auch wenn wir Räuber und Poli spielten, genügte die Fläche
der grünen Insel. Wir waren in dieser Bande sieben bis zehn Kinder und fanden
irgendwo in den Hinterhöfen, Gärten und Werkstätten immer einen Unterschlupf.
|
Als wir grösser wurden, gehörte uns die ganze Altstadt, der See, die
Uferpromenade und natürlich auch der Zürichbergwald mit Wellenbad und
Eisfeld. Denn oben am Römerhof gingen wir zur Schule, unten im Seefeld ins
Turnen und in Hirslanden ins Basketballtraining.
|
Und dennoch, obwohl ich die Stadt liebte und sie wie meine Westentasche
kannte, hatte ich, wie so viele in diesem Alter, die romantische Vorstellung,
später einmal, wenn ich Kinder hätte, fern vom Grossstadttrubel, irgendwo
draussen auf dem Lande zu wohnen.
|
Ich habe es dann ausprobiert, das Haus auf dem Lande. Ein kurzes Intermezzo,
muss ich sagen. Ein knappes Jahr haben wir durchgehalten, in einem schönen
Dorf am Hallwilersee. Die Natur stimmte, wir hatten ein Boot, einen Hund und
waren frisch verliebt. Aber das half auch nichts gegen das Heimweh nach der
Stadt, gegen die Sehnsucht nach der geheimnisvollen Stimmung, wenn der Abend
hereinbricht. Nach ein paar Monaten zog es uns mit Macht zurück und seither
weiss ich, dass ich ihn brauche, diesen im Verhältnis zu Tokyo, New York,
London so kleinen und überschaubaren Moloch, der noch zu Fuss durchstreifbar
ist, dem man jederzeit mit einem Spaziergang entfliehen kann, hinauf auf
Uetli- und Zürichberg, nach dem man sich, wenn man oben ankommt, jedoch gerne
wieder umsieht und es gut findet, dass man dort unten irgendwo aufgewachsen
ist und zu Hause ist.
|
Ein wichtiger Anteil des Wohlbefindens in dieser Stadt kommt dem See zu und
dem Fluss, über die schon die Dichter des neunzehnten Jahrhunderts
wunderschöne Heimwehgedichte und Novellen geschrieben haben. Auch wenn sie
eher gesellschaftliche Aussenseiter waren, gehörte ihnen diese Stadt.
|
Die Verpflichtung der Stadt
|
Als mein Vater irgendwann in den Sechzigern dieses Jahrhunderts, mit uns das
Musical "Mini chli Stadt" besuchte, sang Zarli Carigiet als Clochard das
Lied:
|
Mis Dach isch dä Himmel vo Züri,
Und s'Bellevuee mis Bett, woni pfus,
Und d'Schipfii mis Bänkli,
Und d'Meisee mis Schränkli,
Und Züri, ganz Züri mis Hus.
|
Schon als Kind erfasste ich intuitiv, dass die Clochards, die damals immerhin
noch in den Tramhäuschen nächtigten, eigentlich keine Rechte hatten, und
dieses Lied genausogut eine falsche Idylle wie ein Schelmlied darstellte.
Eine Stadt, die diesen Namen verdient, muss aber stets der Verwirklichung
ihrer aus frühen Zeiten der Menschheitsgeschichte stammenden Utopie
("Stadtluft macht frei") nachstreben und die Garantie verschaffen, dass
jeder, der sich hier aufhält, unabhängig von Religion, Geschlecht, Hautfarbe
und dem Inhalt seines Portemonnaies in ihr seine Heimat sehen kann.
|
Sogar mein Unterbewusstsein outet mich als unverbesserlicher Stadtfan. In
meinen glücklichsten Träumen liege ich nicht etwa mit einem Glas Cocktail an
einem Palmenstrand oder bewege mich gar auf dem Rücken eines Kamels durch die
Wüste. Vielmehr durchstreife ich unbekannte Strassenschluchten und finde es
ungeheuer aufregend, eine neue Grossstadt kennenzulernen.
|
|

|
[Inhaltsverzeichnis]
[vorheriger]
[nächster]
|
|
 |


|
 
|
   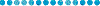 

|

